Alles rund um die Psychische Gefährdungsbeurteilung
- Melanie Faltermeier
- 26. Apr. 2023
- 6 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 8. Mai 2024
Warum sie eine Bereicherung für Unternehmen darstellt.
Wir haben bereits einige Unternehmen dabei begleitet, das Thema Psychische Gesundheit im Unternehmen erfolgreich einzubetten. Eine, unter anderem gesetzlich verpflichtende, Maßnahme ist dabei die Durchführung einer Psychischen Gefährdungsbeurteilung, welche Unternehmen dabei unterstützt, Risikofaktoren im Unternehmen zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen abzuleiten.

Zu Beginn eine Begriffserklärung
Im arbeitspsychologischen als auch -medizinischen Fachjargon wird mit "Psychischer Belastung" eigentlich "Psychische Beanspruchung" ausgedrückt - nach dem Belastungs-Beanspruchungskonzept nach Rohmert (1984; zitiert nach Rossbach et al., 2007). Psychische Belastung wird als der objektiv auf den Menschen gleichermaßen einwirkende Faktor verstanden (neutrale Konnotation), während die psychische Beanspruchung auf die subjektive und individuelle Verarbeitung sowie Bewältigung der Einflüsse abzielt (positive oder negative Konnotation) (Oppolzer, 2010). Umgangssprachlich wird jedoch häufiger von "Belastung" gesprochen, weshalb wir uns zum besseren Verständnis ebenfalls hierauf einigten, wenngleich von "Beanspruchung" die Rede sein müsste.
Was ist die Psychische Gefährdungsbeurteilung und warum ist sie so vielen Unternehmen noch unbekannt?
Seit 01.01.2014 sind alle deutschen Unternehmen durch das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet, neben der Physischen Gefährdungsbeurteilung auch eine Psychische Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Bei der Psychischen Gefährdungsbeurteilung werden alle psychischen Belastungen von Mitarbeitenden innerhalb eines Unternehmens ermittelt, dokumentiert und beurteilt, um ableitend Maßnahmen ergreifen zu können (§3, §5 ArbSchG). Somit werden nicht mehr nur physische Belastungen und Risikofaktoren durch die Einhaltung des Arbeitsschutzes ermittelt und behandelt, sondern auch psychische Belastungen (Hahnzog, Meyer-Tischler & Faltermeier, 2022).
Ein Grund warum viele Unternehmen die Psychische Gefährdungsbeurteilung noch nicht umsetzen oder sie erst gar nicht kennen, ist, dass die Psychische Gefährdungsbeurteilung ein (vergleichsweise) recht junges Instrument des Arbeitsschutzes darstellt - postuliert die Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz (im Folgenden: BAUA) (BAUA, 2023). Sogar große und bekannte Unternehmen stehen hierbei noch im Stadium der Entwicklung und versuchen Licht ins Dunkle zu bringen. Im Bezug auf die Durchführung, Umsetzung und Voraussetzungen der Psychischen Gefährdungsbeurteilung stellen sich viele Unternehmer:innen oder Verantwortliche der Belegschaft oder des Arbeitsschutzes Fragen (BAUA, 2023).
Zahlen, Daten, Fakten über die Psychische Gefährdungsbeurteilung
Im Falle des Nachweises einer psychischen Erkrankung bei einem Mitarbeitenden, können Arbeitgebende von Kranken- oder Rentenversicherung, wie auch der Berufsgenossenschaft dazu aufgefordert werden, die anfallenden Kosten zu übernehmen (Hahnzog, Meyer-Tischler & Faltermeier, 2022).
Die Psychische Gefährdungsbeurteilung sollte etwa alle 3 Jahre, oder wenn es im Unternehmen starke Umstrukturierungen gibt, fortlaufend aktualisiert werden (Hahnzog, Meyer-Tischler & Faltermeier, 2022).
Nach Angaben der BAUA lagen die Kosten für den Produktionsausfall aufgrund psychischer und Verhaltensstörungen 2021 bundesweit bei 15,8 Milliarden Euro (BAUA, 2022). Die Wichtigkeit der Psychischen Gefährdungsbeurteilung lässt sich unter anderem aus diesen Zahlen herleiten.
Eine Studie von Beck und Lenhardt (2019) zeigte, dass besonders kleinere Unternehmen in Deutschland bei der Durchführung der psychischen Gefährdungsbeurteilung große Defizite aufweisen. Die Ergebnisse zeigen auch, dass Unternehmen mit Einsatz professioneller Arbeitsschutzexperten zu einer Verbesserung der Defizite beitragen können. Die Daten zeigen außerdem, dass sich bei 82 Prozent der Unternehmen, nach Durchführung und fortlaufender Aktualisierung, ein positiver Nutzen einstellt (Beck & Lenhardt, 2019).
Warum ist es wichtig, die Psychische Gefährdungsbeurteilung durchzuführen?
Sowohl Unternehmen als auch Mitarbeitende profitieren von der Implementierung der Psychischen Gefährdungsbeurteilung. Sie unterstützt Unternehmen auf ihrem Weg sich den immer wiederkehrenden Veränderungen der Arbeitswelt, wie beispielsweise der Digitalisierung oder dem hybriden Arbeiten seit Corona, anzupassen und sich stetig weiterzuentwickeln, wie auch Verbesserungsprozesse anzustoßen. Ungewollte Fehlbeanspruchungen können in Zukunft vermieden werden und die Arbeitsbedingungen lassen sich durch die von der Psychischen Gefährdungsbeurteilung herausgearbeiteten Maßnahmenvorschläge verbessern. Das führt in der Regel zu zufriedeneren, motivierteren und leistungsfähigeren Mitarbeitenden. Was wiederum in der Regel dazu führt, dass das Arbeitsklima entspannter ist und sich die Produktivität des Unternehmens erhöht (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, 2022).
Zudem wird es in Deutschland, aufgrund der Überalterung der deutschen Bevölkerung, einen großen Mangel an Fachkräften geben (Businessinsider, 2023). Berücksichtigt man zudem die Mitarbeitenden, die aufgrund einer psychischen Erkrankung ausfallen, steigt die Zahl der ausfallenden Fachkräfte zusätzlich. Denn die Zahl der Arbeitsausfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen ist in den letzten 10 Jahren um 48 Prozent gestiegen (DAK, 2023).
Wie wird Psychische Gefährdungsbeurteilung durchgeführt?
Die Kerninhalte einer Psychischen Gefährdungsbeurteilung sind vor allem folgende Merkmalsbereiche:
Arbeitsinhalt bzw. Arbeitsaufgabe
Arbeitsorganisation
Soziale Beziehungen am Arbeitsplatz
Arbeitsumgebung
Neue Arbeitsformen
Gesamteinschätzung der Arbeitssituation (BAUA, 2014, S. 31, und eigene Erkenntnisse)
Die Psychische Gefährdungsbeurteilung kann sowohl in Kombination zur physischen Beurteilung als auch separat erhoben werden. Es empfiehlt sich allerdings die zweite Methodik, da es sich bei der Erhebung von psychischen Belastungen um ein eher sensibles Thema handelt. Vor der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung sollte der ganze Prozess nach bestem Wissen und Gewissen von einer Steuergruppe geplant werden, der im besten Falle Expert:innen beisitzen. Zusätzlich sollten alle Mitarbeitenden über die Durchführung der psychischen Gefährdungsbeurteilung, durch Infoveranstaltungen oder Ähnliches, in Kenntnis gesetzt werden (Hahnzog, Meyer-Tischler & Faltermeier, 2022).
Ist der Planungsprozess abgeschlossen, erfolgt die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung laut den GDA-Leitlinien „Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie – GDA“ der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz, die im Jahr 2012 entwickelt und im Jahr 2017 aktualisiert wurden (Nationale Arbeitsschutzkonferenz, 2018; https://www.gda-portal.de). Die Ergebnisse werden danach dokumentiert, wobei nicht nur auf Risikofaktoren und Belastungen eingegangen wird, sondern auch auf Ressourcen und Stärken. Somit können diese dann weiter ausgebaut werden. Auch Handlungsempfehlungen und Maßnahmen sind abzuleiten und dienen den Unternehmen als Leitfaden. Diese Maßnahmen zielen vor allem darauf ab, eine mittel- bis langfristige Weiterentwicklung des Unternehmens zu bewirken (Hahnzog, Meyer-Tischler & Faltermeier, 2022).
Wie bereits oben beschrieben, sollte die Psychische Gefährdungsbeurteilung in einem Intervall von 3 Jahren oder bei signifikanten Veränderungen in der Unternehmensstruktur aktualisiert werden.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Durchführung der Psychischen Gefährdungsbeurteilung?
Wahrscheinlich ist es eine der größten Herausforderungen, sich auf das Thema mentale Gesundheit einzulassen und es nicht einfach unter den Teppich zu kehren. Doch das ist einer der wichtigsten Kernpunkte: Und zwar, dass sich Mitarbeitende und Führungskräfte auf die Durchführung der Psychischen Gefährdungsbeurteilung einlassen und vor allem Führungskräfte mit gutem Beispiel voran gehen und sich klar zum Thema mentale Gesundheit positionieren (Hahnzog, Meyer-Tischler & Faltermeier, 2022). Eine weitere Herausforderung, die sich bei der Durchführung der Psychischen Gefährdungsbeurteilung ergibt, ist die Einhaltung der Anonymität und Professionalität gegenüber den Mitarbeitenden. Wenn externe Beratende mit dem Prozess und Gesetzgebungen rund um die Psychische Gefährdungsbeurteilung vertraut sind, kann den Mitarbeitenden ein vertraulicher und fachgerechter Umgang mit den erhobenen Daten gewährleistet werden (Hahnzog, Meyer-Tischler & Faltermeier, 2022).
Weitere Herausforderungen, die uns in regelmäßigen Abständen entgegen gebracht werden sind:
Unwissenheit über die Durchführung
Überforderung durch vermeintliche Komplexität
Angst vor Kapazitätsüberlastung
Berührungsängste gegenüber Psychischer Gesundheit
Finanzielle Hürden
Wenn wir eins wissen, dann, dass genau diese Herausforderungen und Bedenken meist anhand eines Gesprächs minimiert werden können.
Welche Vorteile bringt die fortlaufende Durchführung der Psychischen Gefährdungsbeurteilung?
Die Implementierung der Psychische Gefährdungsbeurteilung bringt viele Vorteile mit sich. Einige davon haben wir bereits weiter oben aufgegriffen. Nochmal kurz zur Auffrischung: Mitarbeitende und Unternehmen profitieren in erster Linie, weil Risikofaktoren durch die Psychische Gefährdungsbeurteilung und die Durchführung der Maßnahmen ebendieser Risiken sowie langfristig psychisch bedingte Fehltage reduziert werden können.
Zusätzlich stellen sich weitere Vorteile für Mitarbeitende und Unternehmen ein, da
… Unternehmen sich schnell an Veränderungen in der Arbeitswelt anpassen können
… ungewollte Fehlbeanspruchungen vermieden werden
… die Arbeitsbedingungen sich durch umgesetzte Maßnahmen verbessern können
… sich das Arbeitsklima durch zufriedene Mitarbeiter entspannt
... die Arbeitgeberattraktivität steigt
... die Integration von Psychischer Gesundheit in die Unternehmenskultur als Employer Branding genutzt werden kann
Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema mentaler Gesundheit werden zudem gesellschaftliche Stigmata hinterfragt, wodurch sich eine offene und verständnisvolle Unternehmenskultur entwickeln kann. Diese Auseinandersetzung mit mentaler Gesundheit kann sich auch bei zukünftigen oder potentiellen Mitarbeitenden positiv auswirken und ein gutes Employer Branding zur Folge haben. Dies hat wiederum Auswirkungen auf den Recruiting Prozess.
Die Umsetzung einer professionellen Gefährdungsbeurteilung bringt auf lange Sicht für alle Beteiligten nur Vorteile. Auch wenn es bei der Durchführung durchaus einige Herausforderungen gibt, mit denen Führungskräfte und Mitarbeitende konfrontiert werden. Das Wichtigste ist hierbei nochmals zu erwähnen, dass sich gerade die Verantwortlichen eines Unternehmens auf den Prozess einlassen sollten, damit eine nachhaltig gesundheitsförderliche Unternehmenskultur daraus hervorgehen kann, die es ermöglicht für nachfolgende Generationen ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen.
Du möchtest mehr erfahren?
In unserem Buch "Psychische Gefährdungsbeurteilung: Impulse für den Mittelstand" bekommst Du einen guten Überblick. Bestelle das Buch oder melde Dich bei uns für ein unverbindliches Gespräch unter business@wearemental.de

Du möchtest nichts mehr verpassen?
Melde Dich zu unserem Newsletter an und sichere Dir das kostenlose White Paper zur Integration von Psychischer Gesundheit in die Unternehmenskultur.
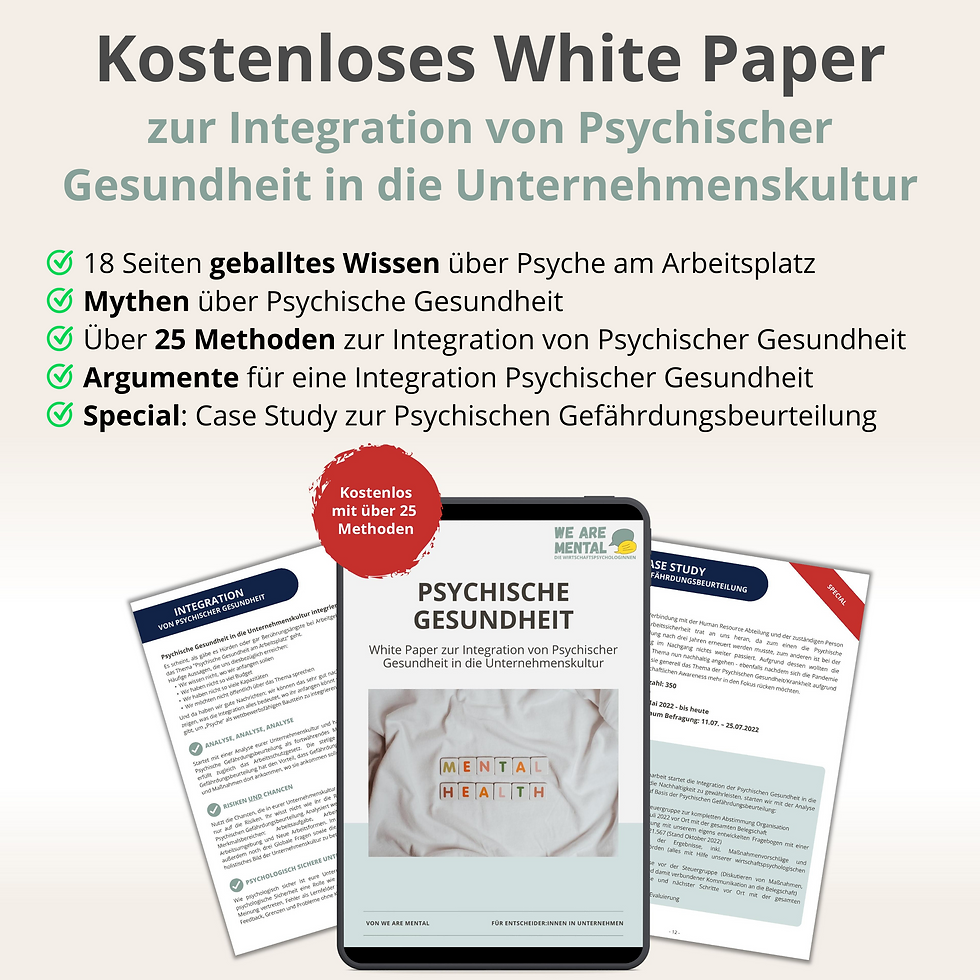
Dieser Beitrag wurde veröffentlicht von Melanie Faltermeier, verfasst von Jelena Taut.
Quellen:
BAUA – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. (2014). Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung – Erfahrungen und Empfehlungen. ESV.
BAUA - Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2022). Volkswirtschaftliche Kosten durch Arbeitsunfähigkeit 2021. https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitswelt-und-Arbeitsschutz-im-Wandel/Arbeitsweltberichterstattung/Kosten-der-AU/pdf/Kosten-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3. Abgerufen am: 15.02.2023
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2023). Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung - Forschung und Entwicklung für die betriebliche Praxis. https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Psychische-Belastung/Gefaehrdungsbeurteilung/Gefaehrdungsbeurteilung_node.html . Abgerufen am: 15.02.2023
Businessinsider (2023). „Nichtstun wäre grob fahrlässig“: Forscher sehen schwarz für Deutschlands Zukunft.https://www.businessinsider.de/wirtschaft/forscher-deutschland-droht-bis-2040-grosser-fachkraeftemangel-2017-8/. Abgerufen am: 15.02.2023
Beck, D., & Lenhardt, U. (2019). Consideration of psychosocial factors in workplace risk assessments: findings from a company survey in Germany. International archives of occupational and environmental health, 92, 435-451.
DAK (2023). Psychreport 2023 - Entwicklungen der psychischen Erkrankungen im Job; 2012 - 2022. https://www.dak.de/dak/download/report-2609620.pdf. Abgerufen am: 15.02.2023
Hahnzog, S., Meyer-Tischler, M., & Faltermeier, M. (2022). Psychische Gefährdungsbeurteilung. In Psychische Gefährdungsbeurteilung: Impulse für den Mittelstand (S. 27-35). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Nationale Arbeitsschutzkonferenz. (2018). Leitlinie Beratung und Überwachung bei psychischer Belastung am Arbeitsplatz. http://www.gda-portal.de/de/pdf/Leitlinie-Psych-Belastung.pdf?__blob=publicationFile&v=9. Abgerufen am: 17. Januar 2023.
Oppolzer, A. (2010). Psychische Belastungsrisiken aus Sicht der Arbeitswissenschaft und Ansätze für die Prävention. In B. Badura (Hrsg.), Fehlzeiten Report 2009 – Arbeit und Psyche: Belastungen reduzieren – Wohlbefinden fördern (S. 13–22). Springer Medizin.
Rossbach, B., Löffler, K. I., Mayer-Popken, O., Konietzko, J., & Dupuis, H. (2007). Belastungs- und Beanspruchungskonzept. Handbuch der Arbeitsmedizin–1. Erg. Lfg, 3(07).
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (2022). Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung: Handlungshilfe für die betriebliche Praxis. https://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere/Themen/Arbeitsschutz_org[…]eurteilung_psychischer_belastung.pdf?__blob=publicationFile&v=6. Abgerufen am: 15.02.2023







