Psychische Krankheiten entstehen nicht nur im Kopf
- Melanie Faltermeier
- 3. Sept. 2025
- 5 Min. Lesezeit
Zusammenspiel von Körper und Psyche verstehen + hilfreiche und praktische Übungen
In der mentalen Gesundheitsdebatte wird oft suggeriert, psychische Erkrankungen seien ausschließlich „Kopfsache“. Dieses Bild greift jedoch zu kurz und kann Betroffene sogar entlastend überraschen: Psychische Gesundheit und körperlichen Zustand sind eng miteinander verwoben, und viele psychische Symptome haben körperliche Ursachen oder werden durch körperliche Erkrankungen verstärkt.

Wenn der Körper die Seele beeinflusst: Das Zusammenspiel verstehen
Chronische körperliche Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Schmerzen oder Autoimmunerkrankungen wirken sich nachweislich auf die psychische Gesundheit aus (Gatchel et al., 2007). Die körperlichen Beschwerden erzeugen oft Stress, Angstzustände, depressive Verstimmungen und Erschöpfungszustände, ohne dass diese psychischen Probleme als „primär“ im Sinn einer rein psychischen Erkrankung anzusehen sind. Der Körper sendet Signale, die wir ernst nehmen müssen.
Neben der direkten Belastung wirken körperliche Erkrankungen biochemisch auf das Gehirn und das autonome Nervensystem ein, beeinflussen das Immunsystem und hormonelle Prozesse – ein Wechselspiel, das oft unterschätzt wird (Kiecolt-Glaser, 2010). So können chronische Entzündungen und Schmerzen neurochemische Veränderungen hervorrufen, die depressive Symptome begünstigen (Dantzer et al., 2008).
Psychische Erkrankungen haben vielfältige Ursprünge und entstehen selten monokausal. Biologische, psychologische und soziale Faktoren interagieren komplex. Eine körperliche Krankheit kann:
psychische Symptome auslösen
bestehende psychische Erkrankungen verstärken
die Behandlung psychischer Erkrankungen erschweren (mit Auswirkungen auf Compliance und Prognose)
Umgekehrt beeinflussen psychische Belastungen körperliche Gesundheit negativ, etwa durch Stresshormone, die Entzündungen fördern und Heilungsprozesse verzögern (Schneiderman et al., 2005).
Warum dieses Verständnis wichtig ist
Das Bewusstsein um die somatische Mitwirkung an psychischen Erkrankungen verringert Stigmatisierung und fördert eine ganzheitliche Behandlung. Medizinische und psychotherapeutische Fachkreise setzen zunehmend auf integrative Versorgungsmodelle, die Psyche und Körper gleichermaßen in den Blick nehmen (Engel, 1977). Für Betroffene heißt das konkret: Eine umfassende Diagnostik und Therapie, die alle Ebenen berücksichtigt, ist erfolgsversprechender als ein rein psychisch orientierter Ansatz.
Auch im Alltag sollten wir unsere körperlichen Symptome ernst nehmen und bei psychischen Beschwerden ärztliche Abklärungen nicht scheuen. Müdigkeit, Konzentrationsschwäche oder gedrückte Stimmung können Warnzeichen für körperliche Erkrankungen sein und benötigen eine angemessene Diagnostik.
Was wir lernen können: Achtsamkeit für Körper und Geist
Die Erfahrung zeigt, dass Achtsamkeit – also eine bewusste, nicht wertende Wahrnehmung aller körperlichen und psychischen Prozesse – ein Schlüssel ist, um die Wechselwirkungen von Körper und Psyche besser zu verstehen und zu bewältigen (Kabat-Zinn, 1990).
Achtsamkeit hilft dabei, Symptome frühzeitig wahrzunehmen, Differenzen zwischen körperlichen und psychischen Ursachen zu erkennen und den Umgang mit Beschwerden insgesamt zu verbessern. Das macht sie zu einem wichtigen Werkzeug in der Prävention und Unterstützung von Menschen mit komplexen Gesundheitsproblemen.
Wie du selbst gut für Körper und Geist sorgen kannst
Das Wissen um die enge Verbindung zwischen körperlicher und psychischer Gesundheit zeigt: Selbstfürsorge ist ganzheitlich und umfasst Körper, Geist und Emotionen gleichermaßen. Kleine, praktikable Übungen und Achtsamkeitspraktiken können helfen, dein Wohlbefinden langfristig zu stärken und Warnsignale frühzeitig zu erkennen.
1. Achtsamkeit für den Körper im Alltag
Nimm dir täglich bewusst Zeit, wahrzunehmen, wie sich dein Körper anfühlt. Das können wenige Minuten sein:
Bodyscan: Setze oder lege dich bequem hin, schließe die Augen und richte deine Aufmerksamkeit nacheinander auf verschiedene Körperregionen, zum Beispiel Füße, Beine, Bauch, Brust, Schultern. Versuche, Empfindungen neutral wahrzunehmen, ohne zu bewerten oder verändern zu wollen.
Bewusstes Atmen: Atme tief und langsam ein und aus, beobachte deinen Atemfluss – wie die Luft in deine Lungen strömt und wieder hinaus. Diese einfache Übung hilft, Stress abzubauen und Präsenz zu fördern (Kabat-Zinn, 1990).
Achtsames Gehen: Richte deine Aufmerksamkeit beim Gehen auf deine Schritte, das Heben und Senken der Füße, den Kontakt zum Boden. Schon 5 Minuten genügen, um den Geist zu beruhigen und präsent zu sein.
2. Bewegung und körperliche Aktivität
Regelmäßige Bewegung – angepasst an deine gesundheitlichen Möglichkeiten – wirkt sich positiv auf psychische und körperliche Gesundheit aus:
Schon leichte Aktivitäten wie Spazierengehen, Yoga oder sanfte Dehnübungen können Schmerzen lindern, das Immunsystem stärken und das allgemeine Wohlbefinden verbessern (Gatchel et al., 2007).
Bewegung fördert außerdem die Freisetzung von Endorphinen, den „Glückshormonen“, die stimmungsaufhellend wirken.
3. Bewusste Pausen und Regeneration
Wir leben in einer oft hektischen Welt. Körper und Geist brauchen Pausen, um sich zu regenerieren:
Plane regelmäßige Erholungszeiten ein, in denen du dich bewusst entspannst, zum Beispiel durch Meditation, Musik hören oder ein warmes Bad.
Versuche, Bildschirmpausen einzulegen und Geräte bewusst auszuschalten, um Überstimulation zu vermeiden.
4. Grundhaltung der Selbstakzeptanz
Manchmal ist es schwierig, körperliche oder psychische Beschwerden zu akzeptieren. Achtsamkeitsübungen stärken die Fähigkeit, mit Belastungen mitfühlend umzugehen (Baer et al., 2012):
Übe, dich selbst freundlich wahrzunehmen und auch schwierige Gefühle und Empfindungen nicht abzulehnen, sondern als vorübergehende Erlebnisse zu akzeptieren.
Dies kann das Erleben von Stress und Leid vermindern und deine Resilienz erhöhen.
5. Professionelle Unterstützung suchen
Manche Zusammenhänge zwischen Körper und Psyche bedürfen ärztlicher oder therapeutischer Abklärung:
Nutze bei anhaltenden Beschwerden die Chance zur ganzheitlichen Diagnostik.
Integrative Versorgungsansätze, die Ärzt:innen, Psychotherapeut:innen und andere Fachleute verbinden, haben sich als besonders hilfreich erwiesen.
Fazit: Körper und Psyche – eine starke Einheit für dein Wohlbefinden
Die Verbindung von körperlicher und psychischer Gesundheit ist untrennbar. Indem du deinen Körper bewusst wahrnimmst, achtsame Routinen entwickelst und eine mitfühlende Grundhaltung einnimmst, stärkst du nicht nur dein Wohlbefinden, sondern förderst auch deine mentale Gesundheit auf nachhaltige Weise. Körperliche Beschwerden sind keine Last, sondern wichtige Signale, die dich lehren, achtsam mit dir selbst zu sein. So kannst du besser auf dich achten, Belastungen besser meistern und deine Gesundheit ganzheitlich unterstützen.
Gute Nachricht:
Du bist mehr, als deine Symptome es zeigen! Körperliche und psychische Gesundheit sind Fähigkeiten, die du durch tägliche bewusste Praxis und Selbstfürsorge schrittweise stärken kannst. Jeder kleine Schritt hin zu mehr Achtsamkeit und Selbstakzeptanz macht dich resilienter und schenkt dir mehr Lebensqualität – ein Geschenk, das dir langfristig Kraft schenkt.Dieser Beitrag wurde von Sindy Müller verfasst und von Melanie Faltermeier veröffentlicht.
Du brauchst mehr Impulse, um Psychische Gesundheit bei Euch zu integrieren?
Melde Dich zu unserem Newsletter an und sichere Dir das kostenlose White Paper zur Integration von Psychischer Gesundheit in die Unternehmenskultur.
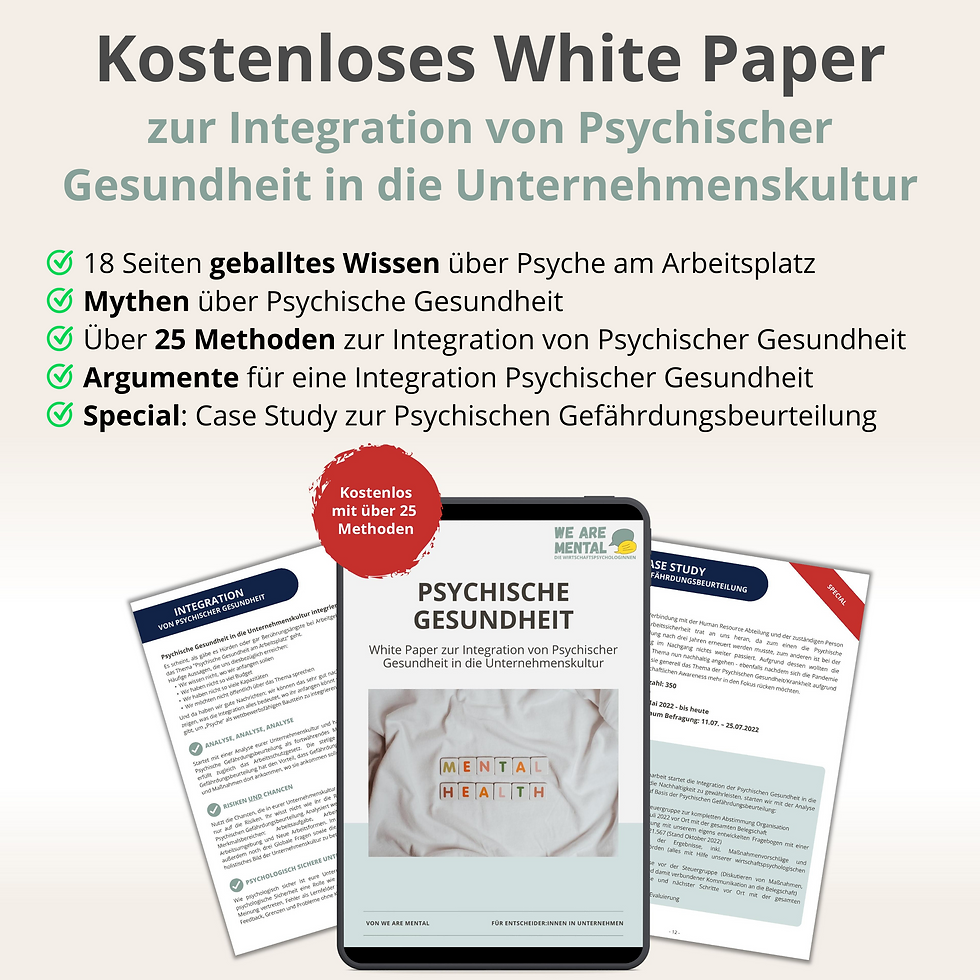
Quellen:
Baer, R. A., Lykins, E. L., & Peters, J. R. (2012). Mindfulness and self-compassion as predictors of psychological well-being in long-term meditators and nonmeditators. Journal of Positive Psychology, 7(3), 230-238. https://doi.org/10.1080/17439760.2012.674548
Dantzer, R., O’Connor, J. C., Freund, G. G., Johnson, R. W., & Kelley, K. W. (2008). From inflammation to sickness and depression: when the immune system subjugates the brain. Nature Reviews Neuroscience, 9(1), 46–56. https://doi.org/10.1038/nrn2297
Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science, 196(4286), 129–136. https://doi.org/10.1126/science.847460
Gatchel, R. J., Peng, Y. B., Peters, M. L., Fuchs, P. N., & Turk, D. C. (2007). The biopsychosocial approach to chronic pain: scientific advances and future directions. Psychological Bulletin, 133(4), 581–624. https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.4.581
Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. Delta.
Kiecolt-Glaser, J. K. (2010). Psychoneuroimmunology and health at the interface of the behavioral and biomedical sciences. American Psychologist, 65(1), 11–20. https://doi.org/10.1037/a0017770
Schneiderman, N., Ironson, G., & Siegel, S. D. (2005). Stress and health: Psychological, behavioral, and biological determinants. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 607–628. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141







