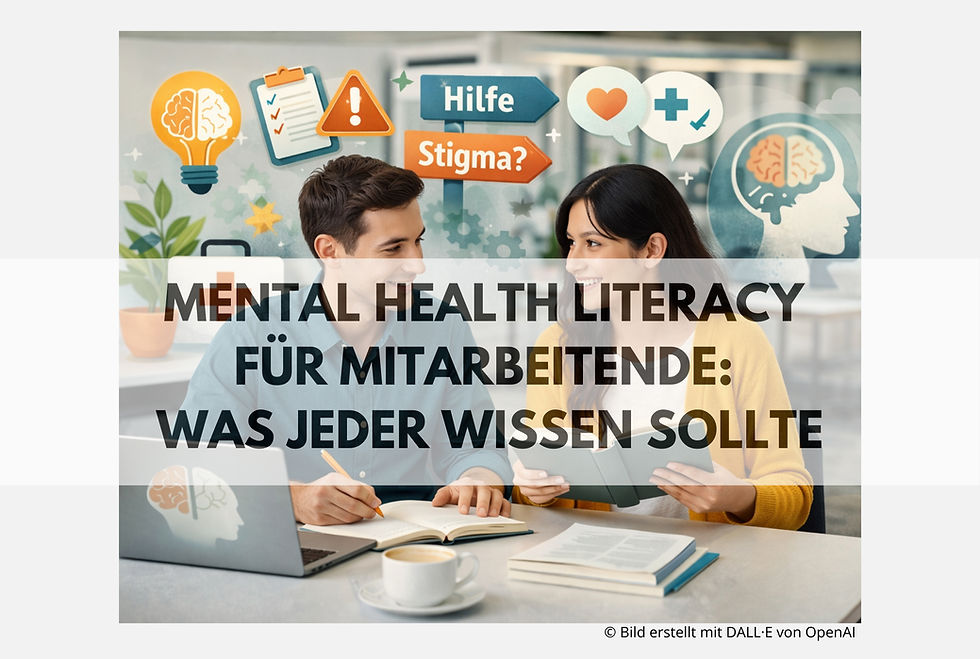Boreout: Wenn Langeweile krank macht
- 24. Mai 2025
- 7 Min. Lesezeit
Ursachen, Symptome, Folgen und praxisnahe Wege zur Prävention
Wer an Erschöpfung im Job denkt, hat meist das Burnout-Syndrom vor Augen. Doch das Gegenteil davon – der sogenannte Boreout – ist ebenso gefährlich und betrifft überraschend viele Beschäftigte. Laut der „Arbeitszufriedenheit in Krisenzeiten“-Studie 2022 von AVANTGARDE Experts fühlen sich 41 % der befragten ArbeitnehmerInnen unterfordert oder sehen ihr Potenzial im Unternehmen nicht ausgeschöpft. In der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen liegt dieser Wert sogar bei 47 %.
Die Folge? Anhaltende Langeweile, innere Leere und körperliche Beschwerden bis hin zur Depression. In Zeiten zunehmender Automatisierung, starrer Arbeitsstrukturen und wachsender Sinnsuche im Job gewinnt das Thema Boreout dramatisch an Bedeutung – für Unternehmen ebenso wie für die Gesundheit der Mitarbeitenden.

Was ist Boreout?
Als Boreout lässt sich ein Zustand beschreiben, bei dem Menschen über längere Zeit hinweg am Arbeitsplatz zu wenig gefordert sind und sich dauerhaft gelangweilt fühlen. Diese anhaltende Unterforderung kann dazu führen, dass sich Unzufriedenheit einstellt, die sowohl körperliche als auch seelische Beschwerden nach sich zieht (Cürten, 2013). Prinzipiell sind vom Boreout vorrangig Berufsgruppen betroffen, deren Tätigkeiten hauptsächlich am Schreibtisch ausgeführt werden (Hofstädter, 2011).
Um das Phänomen Boreout besser zu verstehen, werden die charakteristischen Merkmale nachfolgend einmal näher betrachtet. Dabei treten laut Cürten (2013) typischerweise vier zentrale Kriterien bei dem Boreout-Phänomen auf:
Unterforderung: Mitarbeitende empfinden ihre Aufgaben entweder als mengenmäßig zu gering (quantitative Unterforderung) oder inhaltlich zu anspruchslos (qualitative Unterforderung). Sie fühlen sich unterfordert, verantwortungslos und in ihren Fähigkeiten ungenutzt, was zu Unzufriedenheit führt.
Langeweile: Wer dauerhaft zu wenig zu tun hat oder seit Jahren immer gleiche Routinen durchläuft, erlebt häufig ein Gefühl von Leere. Selbst ursprünglich interessante Tätigkeiten können durch die ständige Wiederholung so monoton wirken, dass sie als sinnlos empfunden werden.
Desinteresse: Die inhaltliche Entkopplung zwischen den eigenen Interessen und den beruflichen Aufgaben führt oft dazu, dass Mitarbeitende keine emotionale Verbindung mehr zur Arbeit und/oder zum Unternehmen verspüren. Beides wird gleichgültig für den Betroffenen.
Lustlosigkeit: Infolge dieser Faktoren entwickelt sich häufig ein Zustand innerer Ablehnung. Der Arbeitsalltag wird zur Belastung, Motivation und Freude sinken, und der Gang zur Arbeit kostet zunehmend Überwindung.
Ursachen eines Boreouts
Die Risikofaktoren, die die Entstehung eines Boreouts wahrscheinlicher machen können sind vielfältig. Folgende Auflistung soll daher eine Orientierung bieten, welche Umstände einen Nährboden für die Entwicklung eines Boreouts darstellen können.
Laut Windbichler (2020) zählen dazu unter anderem strukturelle Aspekte im Arbeitsumfeld:
Beschäftigte werden mit Aufgaben betraut, die weder ihren fachlichen Fähigkeiten noch ihren persönlichen Interessen entsprechen, was zu Demotivation führt.
Die tatsächlichen Tätigkeiten im Job stimmen nicht mit dem erlernten Beruf oder der Qualifikation überein.
Es kommt vor, dass die Realität im Arbeitsalltag stark von den im Vorstellungsgespräch oder in der Stellenausschreibung gemachten Aussagen abweicht, was zu Enttäuschung und Frustration führt.
Berufseinsteiger oder Absolventen werden unter ihrem Potenzial eingesetzt, wodurch ihnen die Möglichkeit fehlt, eigenverantwortlich zu arbeiten oder eigene Ideen einzubringen.
Zusätzlich dazu hebt Cürten (2013) darüber hinaus organisationale und psychologische Rahmenbedingungen hervor, die eine Boreout Entwicklung begünstigen können:
Ein Führungsstil, der durch enge Vorgaben und geringe Entscheidungsfreiheit geprägt ist, lässt kaum Platz für Eigenverantwortung und persönliche Entfaltung, was zu Demotivation führen kann
Wenn Mitarbeitende in ihrer Tätigkeit keinen tieferen Zweck erkennen können, kann dies zu innerer Leere und dem Gefühl führen, dass die eigene Arbeit bedeutungslos ist.
Immer gleiche, monotone Arbeitsabläufe können das Gefühl erzeugen, sich tagtäglich abzumühen, ohne dass dabei etwas wirklich erreicht wird
Eine Unternehmenskultur, in der Erfolge kaum gewürdigt, Rückmeldungen selten gegeben und Leistungen nicht geschätzt werden, kann auf Dauer Demotivation und Desinteresse fördern.
Symptome eines Boreouts
Laut Brühlmann (2015) lassen sich folgende Merkmale charakterisieren, die auf eine chronische Unterforderung hindeuten:
Statt starker Erschöpfung wie beim Burnout steht häufig ein Gefühl innerer Leere und Sinnlosigkeit im Vordergrund.
Auf körperlicher Ebene können Anzeichen wie ständige Müdigkeit und allgemeine Energielosigkeit auftreten.
Emotional zeigt sich Boreout oft durch Antriebslosigkeit, Gereiztheit oder anhaltende Frustration.
Die Motivation leidet spürbar: Betroffene verlieren das Interesse an ihrer Arbeit und können sich kaum noch aufraffen, Aufgaben anzugehen.
Auch die geistige Leistungsfähigkeit ist beeinträchtigt – Konzentrationsschwierigkeiten und eine verminderte Aufnahmefähigkeit sind typische Begleiterscheinungen.
Soziale Rückzugsverhalten, wie Isolation oder ein angespannter Umgang mit Kolleg*innen, können sich ebenfalls bemerkbar machen.
In manchen Fällen entwickeln sich daraus ernsthafte psychische Störungen wie depressive Episoden oder körperliche Beschwerden ohne erkennbare organische Ursache (sogenannte somatoforme Störungen)
Ergänzend deckt die Studie von Dietrich aus dem Jahr 2025 außerdem weitere psychische und psychosomatische Symptome auf, die im Zuge eines Boreouts auftreten können:
Schuld- und Schamgefühle, die mit dem eigenen Leistungsanspruch oder dem Gefühl der Nutzlosigkeit zusammenhängen.
Verlust der Lebensfreude, der sich in einzelnen Fällen bis hin zu Zynismus äußern kann.
Typisch ist auch ein schleichender Verlust des Vertrauens in die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten.
In manchen Fällen dient Drogenmissbrauch als Versuch, der als sinnlos empfundenen und monotonen Realität zu entfliehen.
Auf körperlicher Ebene können Beschwerden wie Rücken-, Magen-, Bauch- oder Kopfschmerzen auftreten, sowie Tinnitus und Schlafstörungen.
Folgen eines Boreouts
Auf organisatorischer Ebene
Boreout kann für Unternehmen erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen. Ein zentrales Problem stellt dabei laut Lawn & Stuart (2019) die Mitarbeiterfluktuation dar, da einige Beschäftigte ihren Arbeitsplatz aufgrund von Langeweile und Frustration verlassen. Die dadurch entstehenden Kosten für die Neubesetzung einer Stelle können sich auf nahezu ein Jahresgehalt belaufen und somit eine wirtschaftliche Belastung für das Unternehmen darstellen (Lawn & Stuart, 2019). Zudem ist Boreout eng mit geringer Arbeitsmoral assoziiert, was wiederum zu geringer Produktivität und geringer Innovationskraft führt. Unternehmen mit wenig engagierten Mitarbeitenden können daher Gefahr laufen deutlich geringere Umsätze zu erzielen als solche mit einem hohen Engagement Niveau (Lawn & Stuart, 2019). Boreout ist darüber hinaus ein soziales Phänomen mit hoher Ansteckungsgefahr: Wenn Führungskräfte oder Kollegen gelangweilt wirken oder darüber sprechen, überträgt sich dieses Verhalten leicht auf andere Mitarbeitende, was die Unternehmenskultur insgesamt negativ beeinflussen kann (Fisher, 1993).
Auf personeller Ebene
Auf individueller Ebene geht Boreout oft mit schädlichen Verhaltensweisen einher, die sowohl der betroffenen Person selbst als auch dem Unternehmen schaden.
Dazu zählen unter anderem
erhöhte Fehlzeiten und Substanzmissbrauch (Dyer-Smith & Wesson, 1997)
häufig eine nachlassende Einhaltung von Sicherheitsvorgaben
eine erhöhte Fehlerquote
verstärkte Neigung zu gesundheitlichen Problemen wie Herzbeschwerden und einer insgesamt ungesünderen Ernährung (Game, 2007)
Diese Effekte summieren sich zu einem gesteigerten Krankenstand, geringerer Produktivität und reduzierter Innovationsleistung, was wiederum nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigt (Game, 2007). Letztlich kann es in Folge eines Boreouts auch zu innerer Kündigung seitens der Mitarbeiter kommen (Cürten, 2013).
Lösungsansätze und Präventionsmaßnahmen für Boreout
Auf Mitarbeiterebene
Ein erster wichtiger Schritt zur Bewältigung eines Boreouts besteht laut Cürten (2023) darin, aktiv zu werden und das eigene Unwohlsein nicht länger zu verschweigen. Betroffene sollten frühzeitig das Gespräch mit ihrer Führungskraft suchen und den Wunsch nach mehr Verantwortung oder herausfordernden Aufgaben äußern. Reagiert das Management darauf nicht konstruktiv, kann ein Wechsel der Position innerhalb des Unternehmens oder sogar ein kompletter Neustart bei einem anderen Arbeitgeber in Betracht gezogen werden. Auch persönliche Weiterentwicklung – etwa durch eine Fortbildung in einem interessanten Themenfeld – oder eine Reduzierung der Arbeitszeit können neue Perspektiven eröffnen und zur Entlastung beitragen (Cürten, 2013).
Auf Führungsebene
Um die Entstehung bestenfalls gänzlich präventiv zu verhindern, wären zudem Schutzmaßnahmen ratsam. Ein möglicher Ansatz zur Prävention oder Linderung von Boreout besteht laut Windbichler (2020) darin, dass Führungskräfte betroffenen Mitarbeitenden mehr Selbstbestimmung in ihrer Arbeit einräumen, um die Motivation zu steigern. Zudem ist es sinnvoll die Aufgaben stärker an deren Qualifikationen und Interessen auszurichten, statt Mitarbeitende an starre Arbeitsrollen anzupassen. Zur wirksamen Prävention gehört außerdem, dass Führungskräfte potenzielle Warnsignale frühzeitig erkennen – etwa durch regelmäßige Mitarbeitergespräche in Kombination mit einem empathischen Führungsstil. So können Führungskräfte durch ehrliches Interesse, aktives Zuhören und offene Kommunikation eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, in der sich Beschäftigte trauen, Über- und Unterforderungen anzusprechen. So können gemeinsam passende Lösungen erarbeitet und langfristige Unzufriedenheit vermieden werden (Windbichler, 2020).
Auf Unternehmensebene
Gemäß der Arbeit von Windbichler (2020) kann es in größeren Betrieben zudem hilfreich sein, eine interne Sozialberatungsstelle einzurichten. Eine solche Anlaufstelle könnte nicht nur explizit bei Boreout, sondern auch bei anderen persönlichen oder sozialen Schwierigkeiten – wie etwa (begleitenden) Suchtproblemen – unterstützend tätig werden. Ihr neutraler Charakter ermöglicht es, Anliegen der Mitarbeitenden vertraulich zu besprechen und gleichzeitig als vermittelnde Instanz zwischen Belegschaft und Unternehmensleitung zu fungieren. Dadurch ließen sich potenzielle Missverständnisse im direkten Austausch vermeiden und Probleme frühzeitig erkennen und angehen (Windbichler, 2020).
Fazit
Boreout ist ein oft unterschätztes, aber durchweg ernstzunehmendes Phänomen, das längst nicht nur das individuelle Erleben betrifft, sondern auch die Leistungsfähigkeit von Unternehmen nachhaltig beeinträchtigen kann. Es entsteht nicht nur durch Unterforderung an sich, sondern vor allem durch das subjektive Gefühl von Sinnentleerung und mangelnder Herausforderung, das Mitarbeitende innerlich lähmt und sowohl die psychische als auch die körperliche Gesundheit erheblich beeinträchtigen kann.
Um dem entgegenzuwirken, sind sowohl individuelle Strategien als auch unternehmerische Maßnahmen erforderlich. Effektive Strategien zur Prävention und Minderung von Boreout müssen deshalb auf mehreren Ebenen ansetzen – von der Unternehmens-, Führungs- bis hin zur Mitarbeiterebene.
Denn eines steht fest: Nur wenn Boreout frühzeitig erkannt, offen thematisiert und auf allen Ebenen ernsthaft adressiert wird, können nicht nur gesündere Arbeitsbedingungen geschaffen, sondern auch ein Klima gefördert werden, das Motivation und Innovationskraft nachhaltig stärkt – zum Vorteil von Mitarbeitenden und Organisation gleichermaßen. Dieser Beitrag wurde von Antonia Römhild verfasst und von Melanie Faltermeier veröffentlicht.
Du brauchst mehr Impulse, um Psychische Gesundheit bei Euch zu integrieren?
Melde Dich zu unserem Newsletter an und sichere Dir das kostenlose White Paper zur Integration von Psychischer Gesundheit in die Unternehmenskultur.
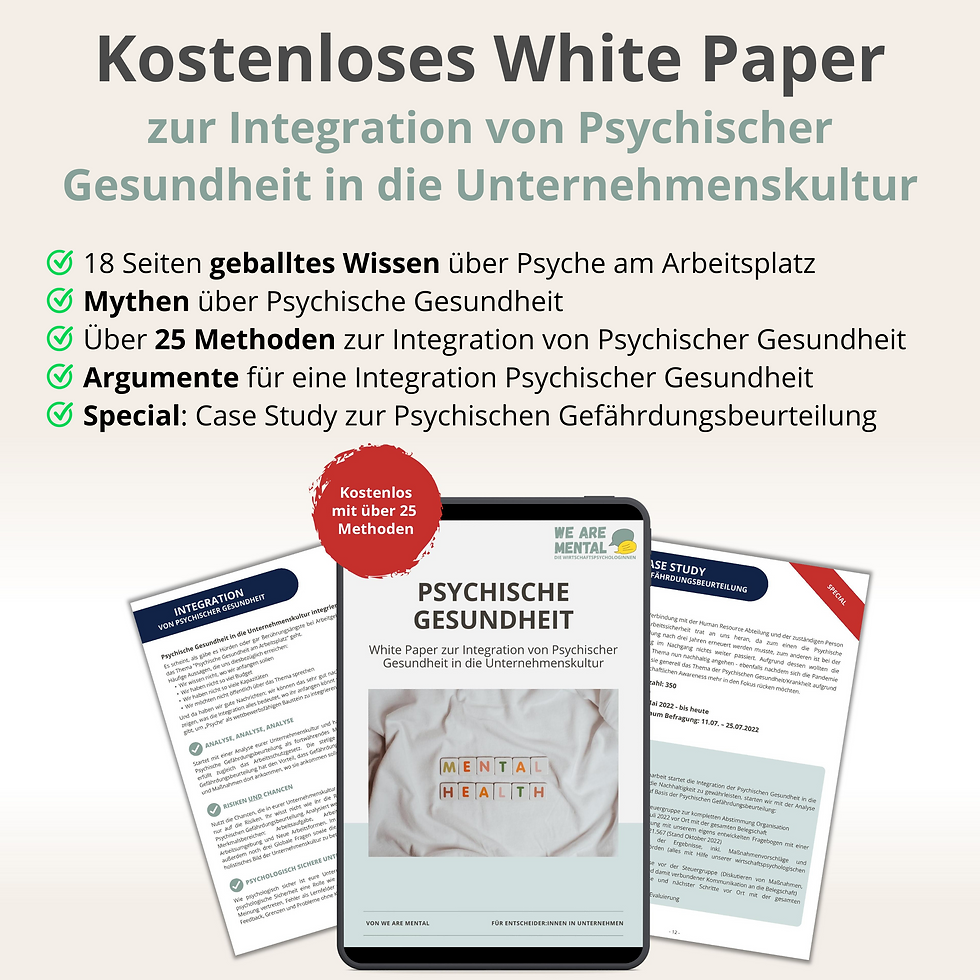
Quellen:
AvantgardeExperts. (2022). Boreout: Ursachen und Folgen von Unterforderung am Arbeitsplatz. https://www.avantgarde-experts.de/de/magazin/unterforderung-arbeitsplatz-boreout/#c9364
Brühlmann, T. (2015). Gesundheitsschädigender Stress durch Über- oder Unterforderung: Müdigkeit bei Burnout und Boreout. In AUF DEN PUNKT GEBRACHT: Bd. SMF 387–SMF 388. https://pdfs.semanticscholar.org/d477/4d62bb951687e98c377b9f58012d4e7c3f40.pdf
Cürten, S. (2013). Boreout-Syndrom und Coaching. Organisationsberatung Supervision Coaching, 20(4), 473–478. https://doi.org/10.1007/s11613-013-0347-8
Dietrich, F. (2025). Ursachen und Folgen von Boreout – eine Literaturstudie. https://www.researchgate.net/publication/389422596_Ursachen_und_Folgen_von_Boreout_-_Eine_Literaturstudie/fulltext/67c1af4e461fb56424ece263/Ursachen-und-Folgen-von-Boreout-Eine-Literaturstudie.pdf?origin=publication_detail&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmxvYWQiLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbiJ9fQ
Dyer-Smith, M. B. A. & Wesson, D. A. (1997). Resource allocation efficiency as an indicator of boredom, work performance and absence. Ergonomics, 40(5), 515–521. https://doi.org/10.1080/001401397187991
Fisher, C. D. (1993). Boredom at Work: A Neglected Concept. Human Relations, 46(3), 395–417. https://doi.org/10.1177/001872679304600305
Game, A. M. (2007). Workplace boredom coping: health, safety, and HR implications. Personnel Review, 36(5), 701–721. https://doi.org/10.1108/00483480710774007
Hofstädter, J. (2011). Leiden im Job - zwischen Boreout und Burnout [Diplomarbeit]. In Prof. Dr. Andreas Hollidt & Prof. Mag. Erich Greistorfer, Hochschule Mittweida, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (S. 61). https://monami.hs-mittweida.de/frontdoor/deliver/index/docId/1347/file/Leiden_im_Job_zwischen_Boreout_und_Burnout.pdf
Lawn, K. & Stuart, C. (2019). THE BOREDOM BOOM: WORKPLACE ‘BORE-OUT’ AND HOW TO STOP IT. In BakerStuart Limited. https://bakerstuart.com/wp-content/uploads/2019/07/The-Boredom-Boom-FINAL.pdf
Windbichler, K. (2020). Boreout in Unternehmen als Folge von Umstrukturierungen? [Masterarbeit, Karl-Franzens-Universität Graz]. https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/6034523?originalFilename=true