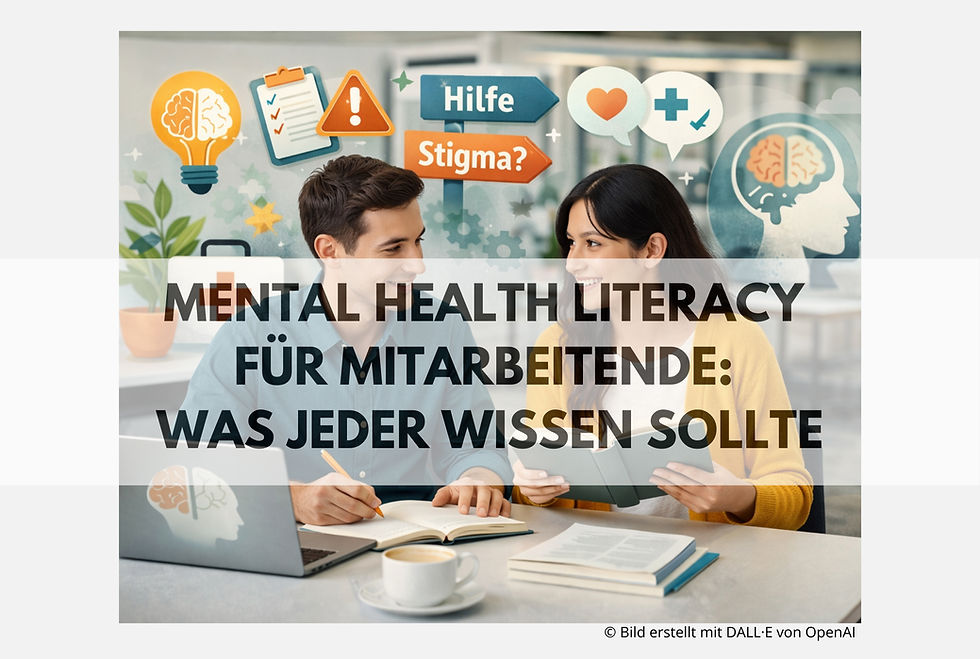Telepressure: zwischen „immer erreichbar“ und „abgeschaltet“
- 12. Juni 2025
- 4 Min. Lesezeit
Definition, Folgen, Maßnahmen und warum Erholung so wichtig ist
Teams, Slack, WhatsApp, E-Mail, Telefon, Zoom, Instagram, LinkedIn. Immer erreichbar. In unserer digitalisierten Arbeitswelt erleben viele das Phänomen der sogenannten Telepressure – den inneren Druck, stets auf berufliche Nachrichten zu reagieren. Dieses Gefühl, ständig verfügbar sein zu müssen, beeinträchtigt unsere Fähigkeit zur Erholung. Studien zeigen: Allein die Wahrnehmung dieser ständigen Erreichbarkeit schränkt die psychologische Abgrenzung vom Beruf stark ein (Hu et al., 2019; Santuzzi & Barber, 2018).

Was ist Telepressure?
Telepressure beschreibt eine psychologisch tiefgreifende Dynamik: den gefühlten Druck, schnell und jederzeit auf arbeitsbezogene Nachrichten (E-Mails, Chatnachrichten, Anrufe) zu reagieren – unabhängig von Tageszeit, Ort oder Kontext (Santuzzi & Barber, 2018).
Typische Anzeichen für Telepressure:
Sofortreaktions-Zwang: Das Gefühl, eine E-Mail oder Nachricht müsse sofort beantwortet werden. Auch abends oder am Wochenende.
Mentale Dauerverfügbarkeit: Auch ohne Nachrichteneingang bleibt das Gefühl präsent, erreichbar sein zu müssen.
Selbstüberforderung: Der Impuls entsteht oft aus inneren Überzeugungen („Ich darf niemanden warten lassen“, „Nur so bleibe ich professionell“), nicht durch äußeren Druck.
Studien zeigen: Besonders betroffen sind Beschäftigte ohne klar geregelte Kommunikationsrichtlinien und solche mit starker Identifikation mit der Arbeit (Hu et al., 2019).
Telepressure ist nicht auf Führungsebenen beschränkt – auch Auszubildende, Berufseinsteiger:innen und Teilzeitkräfte sind betroffen, insbesondere in digitalisierten Umgebungen ohne klar definierte Ruhezeiten (Barber & Santuzzi, 2015).
Telepressure und die Folgen
Telepressure wirkt schnell, nachhaltig und oft unbemerkt. Betroffene reagieren nicht nur schneller, sie denken auch ununterbrochen an offene Aufgaben, Rückmeldungen und Erwartungen.
Kurzfristige Folgen:
Erhöhte Anspannung – auch abends und am Wochenende
Reduzierte Konzentrationsfähigkeit im Arbeitsalltag
Störungen im Einschlafverhalten (Gedankenkreisen)
Langfristige Folgen:
Chronische Erschöpfung & Schlafmangel
Emotionale Gereiztheit & Rückzugstendenzen
Reduziertes Selbstwirksamkeitserleben („Ich schaffe nie wirklich Pause“)
Besonders gravierend: Telepressure senkt die Fähigkeit, in der Freizeit neue Energie aufzubauen – ein Kernfaktor für Arbeitszufriedenheit und Resilienz (Van Laethem et al., 2018).
Auf Organisationsebene:
Mehr Krankheitstage, besonders durch stressbedingte Beschwerden
Leistungsabfall durch kognitive Erschöpfung
Kultur des Misstrauens, wenn „Antwortzeiten“ unbewusst zur Bewertungskategorie werden
Warum Erholung so wichtig ist
Das Effort-Recovery-Modell (Meijman & Mulder, 1998) beschreibt, wie sich unser Körper und Geist nach Belastung regenerieren: Nur durch echte Unterbrechung von arbeitsbezogenen Anforderungen können sich physiologische Systeme zurück in den Erholungszustand bewegen.
Doch genau diese Unterbrechung gelingt bei Telepressure nicht:
Ständige gedankliche Verfügbarkeit hält das sympathische Nervensystem aktiviert. Vergleichbar mit einem Auto im Leerlauf, das trotzdem Sprit verbraucht.
Der sogenannte „psychologische Detachment“ – also das bewusste Abschalten von der Arbeit – wird verhindert (Sonnentag & Fritz, 2007).
Fehlende Erholung zeigt sich in Schlafstörungen, emotionaler Erschöpfung und kognitiver Ermüdung.
Langfristig steigt das Risiko für Burnout, depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden (Derks et al., 2014; Hu et al., 2019).
Darum ist mentale Erholung kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Individuell und betrieblich.
Maßnahmen für echte Erholung
a) Klare Regeln zur Erreichbarkeit einführen
Verbindliche „digitale Ruhezeiten“ z. B. zwischen 19:00–7:00 Uhr
Signatur-Vorlagen wie: „Ich lese Mails werktags zwischen 9–17 Uhr. Vielen Dank für Ihr Verständnis.“
Tool-Tipp: „Send Later“-Funktion aktiv nutzen. E-Mails planen statt nachts senden
b) Technische Maßnahmen nutzen
Betriebsweite Einführung von „Nicht-Stören-Zeiten“ in Kalender- oder Chat-Tools
Abschalten von Push-Benachrichtigungen
Eindeutige Kanäle für wirklich dringende Kommunikation
c) Mikropausen & Mini-Routinen etablieren
Mini-Interventionen wie Atempausen, Mobilitätseinheiten oder Reflexionsfragen
Tools wie „Pomodoro-Timer“ zur bewussten Arbeits- & Erholungsstruktur
Integration von Erholungswissen in Trainings und Schulungen
d) Reflexion & Führungskultur
Dialogrunden: „Wann empfindest du Druck, erreichbar zu sein?“
Führungskräfte als Vorbild: Nicht auf Nachrichten nach Feierabend reagieren
Regelmäßige Evaluation: Was funktioniert, was nicht?
Studien zeigen: Je klarer die Erwartungen kommuniziert und vorgelebt werden, desto besser gelingt Erholung im Team (Barber & Santuzzi, 2015).
Fazit
Telepressure ist ein leiser, aber wirkungsvoller Störfaktor im modernen Arbeitsleben. Es reicht nicht aus, E-Mails später zu beantworten. Wir müssen auch lernen, den inneren Druck zur sofortigen Reaktion zu reduzieren. Wer dauerhaft psychisch präsent bleibt, regeneriert nicht.
Die gute Nachricht: Mit klaren Regeln, technischer Unterstützung, Routinen und bewusster Führungskultur lässt sich echte digitale Erholung gestalten. Individuell und organisatorisch.Dieser Beitrag wurde von Melanie Faltermeier verfasst und veröffentlicht.
Du brauchst mehr Impulse, um Psychische Gesundheit bei Euch zu integrieren?
Melde Dich zu unserem Newsletter an und sichere Dir das kostenlose White Paper zur Integration von Psychischer Gesundheit in die Unternehmenskultur.
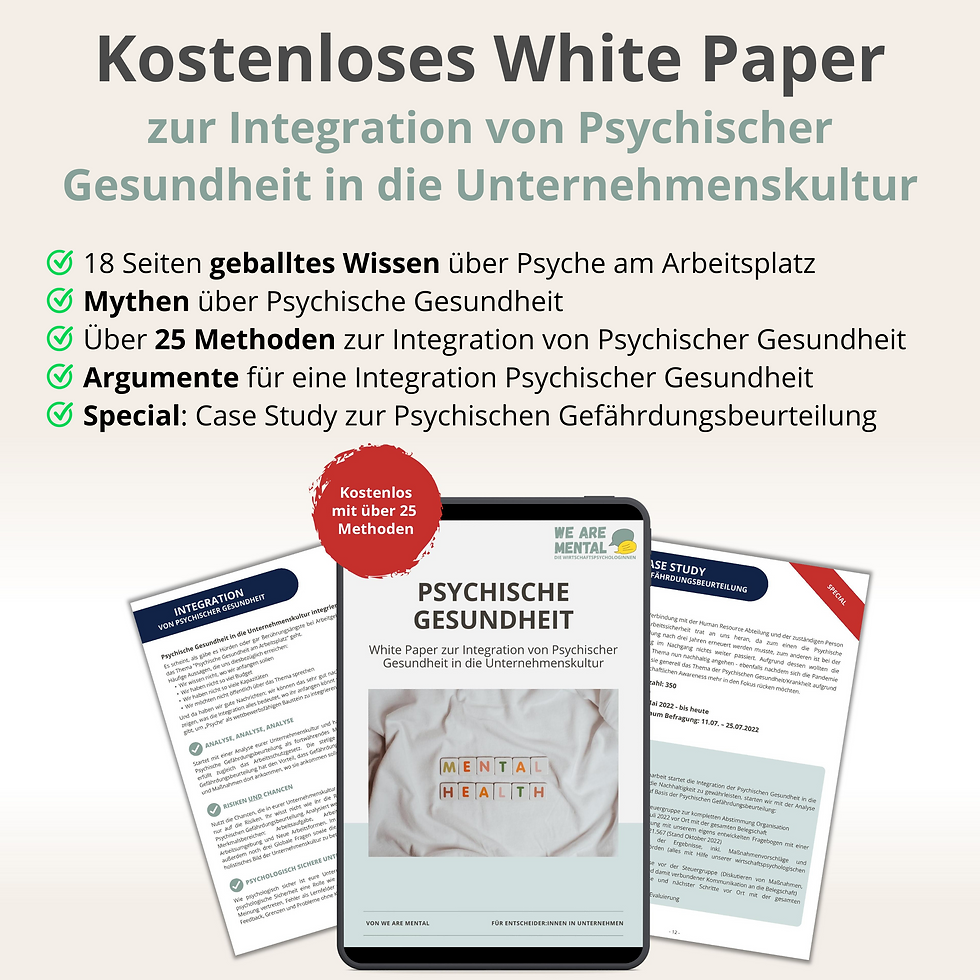
Quellen:
Barber, L. K., & Santuzzi, A. M. (2015). Please respond ASAP: Workplace telepressure and employee recovery. Journal of Occupational Health Psychology, 20(2), 172–189. https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0038278
Derks, D., van Mierlo, H., & Schmitz, E. B. (2014). Smartphone use after hours and work–home interference: The moderating role of social norms and employee work engagement. Journal of Managerial Psychology, 29(4), 384–400. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jmp-08-2012-0237/full/html
Hu, X., Grawitch, M. J., Barber, L. K., & Bernatzky, M. (2019). Disconnecting to detach: The role of impaired recovery in negative consequences of workplace telepressure. Journal of Work and Organizational Psychology, 35(1), 9–15. https://journals.copmadrid.org/jwop/art/jwop2019a2
Meijman, T. F., & Mulder, G. (1998). Psychological aspects of workload. In P. J. D. Drenth, H. Thierry & C. J. de Wolff (Eds.), Handbook of work and organizational psychology (2nd ed., Vol. 2, pp. 5–33). Psychology Press.
Santuzzi, A. M., & Barber, L. K. (2018). Workplace telepressure and the restoration of psychological detachment: The role of affect regulation strategies. Occupational Health Science, 2(1), 1–26. https://link.springer.com/article/10.1007/s41542-018-0022-8
Sonnentag, S., & Fritz, C. (2007). The Recovery Experience Questionnaire: Development and validation of a measure for assessing recuperation and unwinding from work. Journal of Occupational Health Psychology, 12(3), 204–221. https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F1076-8998.12.3.204
Van Laethem, M., van Vianen, A. E. M., & Derks, D. (2018). Daily fluctuations in smartphone use, psychological detachment, and work engagement: The role of workplace telepressure. Psychologica Belgica, 58(1), 20–36. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2018.01808/full